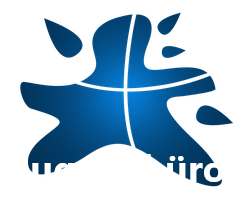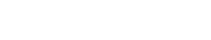2014-07-30 Schwester M. Magdalena
Was anliegt, das mache ich!
Von Delia Evers | Sr. Maria Magdalena wird 75 Jahre alt
Heute begeht Schwester M. Magdalena, die Oberin des kleinen Elisabeth-Konvents am Georgswall, ihren 75. Geburtstag. Eigentlich möchte sie von diesem Festtag nicht viel wissen, denn erst im Mai hatte sie ihre Goldene Ordensprofess gefeiert. Das hilft ihr in diesem Fall nicht weiter: Heute Abend wird ab 18 Uhr im Garten des Schwesternhauses für alle Gratulanten gegrillt.
Schön, dass wir diese Schwester in Aurich haben. Dabei war M. Magdalena zunächst nicht sonderlich begeistert von der nordwestdeutschen Kreisstadt. Als vor sieben Jahren die Stelle der Oberin in Aurich neu besetzt werden musste, wurde M. Magdalena gefragt, ob sie sich einen Wechsel von Ützdorf am wunderschönen Liepnitzsee nördlich von Berlin nach Ostfriesland vorstellen könne. Sie mochte das Ferienhaus dort, in dem sie als Oberin in herrlicher Natur Kinder, Jugendliche und Erwachsene beherbergte.

Sr. M. Magdalena wird an diesem Mittwoch 75 Jahre alt.
„Das Dorf hatte 35 Einwohner: drei Förster, ein paar Rentner und uns drei Schwestern“, erzählt Sr. M. Magdalena lächelnd. Alles war beschaulich. Sie hätte bleiben können. „Aber ich habe einmal ‚Ja‘ gesagt“, erzählt sie und nahm wie schon in den Jahrzehnten zuvor die Aufgaben an, die sich ihr stellten.
„Ich habe erst einmal in einem Atlas nachgeguckt, wo Aurich liegt“, gesteht sie. Dann war sie plötzlich Opfer dieses Ohrwurms: „An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, da sind die Fische im Wasser und selten an Land.“ Der geistsprühende Liedtext entfaltete nicht gerade Sogwirkung auf die Schwester, die im thüringischen Kreis Eisenach zu Hause war. Und dann las sie, die von Aurich zuvor nie gehört hatte, gleich zweimal hintereinander in der Zeitung von Unglücksfällen in der Kreisstadt. „Das fing ja gut an!“
Als sie hier war, fand sie die Häuser zum Verwechseln ähnlich, nichts Helles und Buntes wie in Ützdorf: nur rote Klinker und rote Dächer, grüne Türen und weiße Fensterrahmen. „Einmal musste ich zum Moorweg und fuhr los.“ Sie hatte keine Ahnung, dass hier jede größere Häuseransammlung einen eigenen Moorweg hat und landete im falschen Dorf. Doch bald gewöhnte sie sich ein, freute sich an der lebendigen St.-Ludgerus-Gemeinde und der ebenso lebendigen Pfarreiengemeinschaft, hatte irgendwann heraus, dass alle den Pfarrer duzten, und tat ihre Arbeit, wie sie sie seit langem kannte.
Dabei hatte in den 50er-Jahren bei dem jungen Mädchen, das damals noch Elisabeth Döring hieß und im DDR-Kreis Eisenach unmittelbar an der Grenze zum westdeutschen Hessen lebte, nichts auf einen Klostereintritt hingedeutet. Wohl war sie in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Vater Edmund, ein Schuhmacher, Mutter Christina, eine Schuhverkäuferin, und die acht Kinder gingen sonntags zur Kirche, obwohl dieser Gang in der DDR alles andere als selbstverständlich war. Wer sich zu seinem Glauben bekannte, brauchte ein dickes Fell und machte sich keine Hoffnung auf Karriere. Weiter kam nur, wer in der Partei war und an der Jugendweihe teilgenommen hatte.
Das junge Mädchen wurde in Eisenach im „Konsum“ zur Drogistin ausgebildet und wechselte später, da im Drogistenberuf keine Planstelle frei war, in die Konsum-Verwaltung, lernte Buchführung und erledigte die Lohnabrechnungen für die Kellner, die in der genossenschaftseigenen Gastronomie arbeiteten.
Mit Achtung spricht sie über ihren Bruder Hermann, der als Jugendlicher in einer lebensgefährlichen Aktion über die Grenze in den Westen floh und sich dem Orden der Redemptoristen anschloss.
Ein tiefes Erlebnis gab ihrem Leben eine andere Ausrichtung. Sie besuchte in Erfurt Feierlichkeiten zu Ehren der Elisabeth von Thüringen. Die junge Frau war mit den Geschichten rund um die Heilige der Nächstenliebe aufgewachsen und hörte während einer Aufführung einen Gesang. „Der war so schön!“ Den Text weiß sie noch immer: „Komm‘, du meine Freundin.“ Heute sagt sie: „Es war, als wenn es gefunkt hätte.“
Bald darauf hatte Elisabeth Döring eine Woche Urlaub. Zu Hause sagte sie: „Mutter, ich fahr‘ jetzt mal weg.“ Sie wollte Klöster besuchen, um Klarheit über ihre Zukunft zu gewinnen. Im Hospital des Klosters der Schwestern von der Heiligen Elisabeth in Halle bot ihr jemand an: „Wir können jemanden im Labor gebrauchen.“ Elisabeth kündigte beim Konsum mit der klugen Begründung: „Ich kann mich in meinem früheren Beruf als Drogistin weiterbilden.“ Weiterbildung zog in der DDR immer. „Nach 14 Tagen war ich weg.“
Niemand hatte von den Plänen wissen dürfen. „Wir haben das ganz geheim gehalten.“ Sonst wäre Elisabeths Klostereintritt gefährdet gewesen.
Als sie nach Halle gewechselt war und die Parteisekretärin in ihrer Heimatstadt herausfand, dass die „Weiterbildung“ einem Kloster zugute kam, stellte sie Elisabeths Eltern empört zur Rede. Mutter Christina sagte ruhig: „Ob Elisabeth nun in einem langen oder in einem kurzen Kleid den Menschen dient, ist doch egal.“ Dabei blieb es.
1962 trat Elisabeth in das Kloster der Schwestern von der Heiligen Elisabeth ein und bekam den Namen Maria Magdalena; 1963 wurde sie eingekleidet, 1964 legte sie ihre Profess ab.
Über zwei Jahre ging die Ausbildung im klinisch-chemischen Labor und in Hämatologie an einer staatlichen Schule. Sie trug ihr Ordenskleid ohne jede Anfeindung durch Mitschüler.
Rund 20 Jahre arbeitete sie am St.-Elisabeth-Krankenhaus, das ihrem Orden ebenso angegliedert war wie das St.-Barbara-Krankenhaus, in dem sie anschließend rund 15 Jahre wirkte.
In diese Zeit fiel die Wende. Weihnachten 1989 fuhren alle Döring-Geschwister unabgesprochen zum Elternhaus nahe der inner-deutschen Grenze. Sie gingen zu den Befestigungsstreifen. „Wir nahmen uns alle ein Stück Zaun und machten einen Kaninchenstall oder sonstwas daraus.“
Sie bekam ihre Berufung nach Ützdorf. Dort wurde eine Oberin gebraucht. Sr. M. Magdalena sagte wiederum „Ja“. Sie fühlte sich wohl in der Gegend, überall war Wasser, „das war so klar. Wir hatten ein Boot und konnten schippern“; es gab eine Feuchtwiese mit wilden Orchideen, dazu Seggen und Moorgehölze. Die Kinder- und Jugendgruppen, die zu religiösen Wochen kamen, hatten viel zu erleben – in der Natur, bei Spielen und Wanderungen. Sie war gern für die Kinder und Jugendlichen da. Auch Ältere kamen und fanden bei Schwester M. Magdalena ein offenes Ohr. Sie hörte vor allem zu.
Neun Jahre blieb sie, bis der Ruf nach Aurich kam. Tat der Wechsel ihr Leid? „Ich war überall gern“, sagt sie – und knüpfte nahtlos an, besuchte und besucht mit dem Wagen ältere Menschen und schenkt ihnen wieder Ohr und Herz. Ihre Lebensauffassung ist einfach und schön: „Was anliegt, das mache ich.“
Zu ihrem Goldenen Ordensjubiläum hatte Pfarrer Johannes Ehrenbrink gesagt: „Deine Sorge für Kranke, Alte und Einsame ist beeindruckend und vorbildlich. Wie viele Besuche hast du in den Jahren in Aurich mit deinem blauen Polo wohl schon gemacht? Wie oft höre ich bei Besuchen und vor allem auch bei Trauergesprächen: Sr. Magdalena hat sich regelmäßig um meine Frau, um unsere Oma gekümmert und sie besucht, ihr die Krankenkommunion gebracht und Zeit gehabt. Ein unschätzbarer Dienst, den du für Menschen bei uns tust!“
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Beate Eggers sagte damals: „Du lässt dich vom Schicksal anderer berühren und begegnest anderen mit Einfühlungsvermögen, du hilfst, wo du kannst, und dir ist es wichtig, andere froh zu sehen, Freude in die Welt zu bringen, das Positive zu betonen und Katastrophen nicht größer zu machen als unbedingt nötig!“
Sr. M. Magdalena nimmt Menschen an, wie sie sind. Das erhofft sie sich auch von anderen: dass jeder jeden achten möge, gerade sein Anderssein. Einen Gleichgesinnten zu herzen, ist kein Kunststück. Den zu herzen, der anders ist, beflügelt beide.