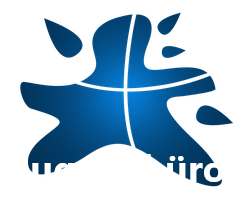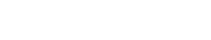Bravouröse Aufführung ohne Happy End
 Es gibt Geschichten, die haben kein Happy End. Dennoch zeigte die Theaterfamilie Gassenhauer Freitag in der vollen Stadthalle, dass auch gelacht werden darf, wenn einer verschwindet.
Es gibt Geschichten, die haben kein Happy End. Dennoch zeigte die Theaterfamilie Gassenhauer Freitag in der vollen Stadthalle, dass auch gelacht werden darf, wenn einer verschwindet.
„Wenn du verschwindest“ – das war der Titel ihrer jüngsten Aufführung zum Thema Demenz. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zeigten eine Geschichte, die ungezählte andere Geschichten barg. Denn wenn einer verschwindet, zerfällt viel mehr als sein Geist.

Margret Fiebig-Drosten, die Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft Aurich/Ostfriesland führte die Gäste „verkleidet“ ins Thema Demenz ein.
Der Plot in Kürze: Angehörige von Demenzkranken treffen sich in einer Selbsthilfegruppe. Sie erzählen von ihren Erfahrungen. In immer neuen, dramatisch kurzweiligen Rückblenden werden ihre Erlebnisse auf der Bühne lebendig.
Aus dem Erzählten, dem Fernen und Fiktiven, wird das pralle Leben.
Das Publikum sitzt mitten drin in diesem Leben – und plötzlich auch im Streitgespräch zwischen Sohn und Schwiegertochter von Oma Roth.
Während Omas Demenz zunimmt und der längst verstorbene Opa Roth in ihrer kranken Welt häusliche Auferstehung feiert, zerbröselt der Familienfrieden. Was soll aus Oma werden? Wohin mit ihr? Ins Heim? Oma abschieben?! Auf keinen Fall, klagen die Enkelkinder.
Gibt es eine bessere Lösung?
Worte büßen ihre Bedeutung ein.
Was ist gut für einen Demenzkranken, was besser oder schlechter? Und was ist gut oder besser oder schlechter für die zunehmend geforderten oder überforderten Familien?
Nichts ist über einen Kamm zu scheren. Gesellschaftlich sanktionierte Regeln, was man macht oder lässt, haben ausgedient.
All diese Fragen sprechen die jungen Darsteller an. Sie nehmen ihr Publikum mit in die kleinen und großen Katastrophen, die sich in den Alltag schleichen – gerade so wie die Demenz selbst sich in den Alltag schleicht und das scheinbar Alltägliche auf den Kopf stellt.

Ruhe gibt es nicht einmal nachts. Oma randaliert in ihrem Schlafzimmer, und die Schwiegertochter findet keinen Schlaf. Alles reduziert sich. Reduziert ist auch das überaus praktische Bühnenbild aus den bewährten Händen von Klaus Schütze. Seine weißen Kisten sind allzwecknützlich.
Was eben noch ulkig war, löst im nächsten Moment einen Ehekrach aus.
Die jungen Darsteller zeigen erstklassiges Schauspiel. Sie verdichten bravourös das komplexe Thema. Sie greifen zu auf das Leben in seiner ganzen Vielschichtigkeit, die viele von ihnen im eigenen Leben längst ertragen mussten.
Ihr Bühnenstück erhebt nicht den Anspruch, noch die letzte Facette auszuleuchten.
Natürlich gibt es mehr als die fünf Familien im Gassenhauer-Stück (in Deutschland geschätzt 1,7 Million Familien mit 1,7 Million dementen Angehörigen). Und natürlich gibt es mehr als das eine Bühnen-Heim, klar: Da sind auch viele, in denen bestmöglich gepflegt und betreut wird.
Die Darsteller zeigen Einzelschicksale aus der Welt von Einzelmenschen.
Sie bringen die ganz großen Gefühle berührend authentisch auf die Bühne: Liebe und Selbsthass, Angst und Verzweiflung, Verrat und Enttäuschung – wie in einer griechischen Tragödie mit unabwendbarem Schicksal.

Familienrat bei den Roths – kein Happy End in Sicht; immer ist die Oma gegenwärtig – und sei es als Foto: Im Bühnenhintergrund laufen während der gesamten Aufführung solche Fotos mit. Sie haben ihre eigene Aussagekraft und sind (erstellt vom Fotoforum Aurich und von der Fotografengruppe „Künstlerische Fotografie“) eine große Bereicherung für das Stück. Sie sagen aus, was die Erkrankten nicht mehr selbst sagen können.
Demenz ist nicht abwendbar und nicht umkehrbar. Sie ist nicht beherrschbar. Die Kranken werden von ihr beherrscht. Das macht eine geradezu dämonische Szene im Stück deutlich. Gefühle haben nicht nur die Angehörigen. Die Kranken selbst gleiten schleichend aus ihrem gewohnten Leben in eine Welt von Einsamkeit, Verlassenheitsgefühl und diffusen Ängsten.

Wie Dämonen umringen die Begleiter von Demenz die Kranke – Unsicherheit, Verzweiflung, Angst und Einsamkeit (Choreografie: Psychologin und Tanzpädagogin Dr. Katharina Lühring).
So geht es auch Opa Ernst. Alle zerren an ihm, er soll für seine alleinerziehende und berufstätige Tochter den Haushalt stemmen und sich um die Enkelkinder kümmern.

Opa Ernst ist ein vielgefragter Mann; alle wollen was von ihm – bis er seinen „Pflichten“ nicht mehr nachkommt.
Er vergisst, die Kinder von der Musikschule abzuholen. Die Tochter muss an ihrer Arbeitsstelle vom Schulsekretariat aus einer wichtigen Besprechung gerufen werfen. Sie ist stinksauer auf ihren Vater und traktiert ihn mit Vorwürfen. Das ist unnötig, denn Opa Ernst spürt sein „Versagen“ selbst. Er hat seine Familie enttäuscht. Er ist fix und fertig. Er merkt, wie er nachlässt.
Dieses Nachlassen erklärt auch die Schwiegertochter von Oma Roth ihren Kindern: „Omas Fähigkeiten werden abnehmen, geistig und körperlich.“ Eine Enkelin fasst zusammen: „Sie wird erst richtig dumm und dann stirbt sie?“ Eine zweite Enkelin folgert: „Als ob wir noch ein Kleinkind bekommen haben – nur dass es sich rückwärts entwickelt?“
Ein Kleinkind lacht und weint und zeigt, was es will. Das kann die Frau von Herrn Rombach schon lange nicht mehr. Sie reagiert auf nichts.
Er pflegt sie hingebungsvoll und sagt bitter: „Ach Liebes, du fehlst mir so. Dein herzliches Lachen, deine helle Stimme, dein Optimismus, deine Zärtlichkeit. Wir waren ein unschlagbares Team. Ich vermisse dich so. Wo bist du geblieben?“
Sie stiert ins Leere. Dabei haben sie schönste Zeiten erlebt. Er besingt sie in einem Lied. Gerade die Größe der Liebe seines Lebens macht ihn nun einsam. Er sehnt sich nach Zweisamkeit und wiederholt sein Versprechen: „In guten wie in schlechten Zeiten.“ Er sagt: „Du kannst dich auf mich verlassen, ich bin da“ – und verliebt sich doch in eine andere Frau. Er kommt mit seinen Schuldgefühlen nicht klar und verliert auch die aufkeimende Liebe.
Dann ist da noch Frau Schulz. Sie ist selbst durch die lange Pflege ihres Mannes körperlich schwer angeschlagen und schafft es nicht, Hilfe zu organisieren. Außenstehende speisen Frau Schulz mit klugen Ratschlägen ab. Sie verfangen nicht. Sie passen nicht.
Allein steht auch Sandra da. Ihr Vater hat einst für eine andere Frau die Familie im Stich gelassen. Jetzt ist er dement und schreit ausgerechnet nach der Frau, die er damals mit den gemeinsamen Kindern sitzen ließ. „Sabiiiine!“ Die Rufe gellen durch Mark und Bein. Sie bündeln die Verzweiflung seiner untergehenden Welt.
Sandra beschimpft ihn als senilen Volltrottel. „Keiner außer mir will dich noch!“ Außer mir? Ganz langsam nähert sich die Tochter dem Vater an. In seinen verqueren Sprüchen entdeckt sie eine Art Weisheit und Humor. Er sagt: „Ich will nicht sterben, das weiß ich. Und wenn, dann als letzter.“
Sandra fasst zusammen: „Ich weiß, er wird es nie wieder schaffen, in meine Welt zu treten, also muss ich in seine Welt eintreten.“ Es gelingt ihr und sie erringt in allem Desaster einen kleinen Frieden.

Sandra schließt Frieden mit ihrem Vater – in ihrem Rücken übergroß ein Foto von ihm. Darin spiegelt sich seine Selbstverlorenheit.
Gibt es Helden in diesen Geschichten? Unbedingt! Es sind die Menschen, die die Kranken aushalten und ihnen in unterschiedlichster Art beistehen. Es sind Angehörige, Freunde, Pflegende und Betreuende, die um Lösungen ringen und sich schuldig fühlen, ohne schuldig zu sein. Anders als Helden in Romanen tragen sie keinen Sieg gegen das Böse davon, weil es in der Demenz kein gut und kein böse gibt; sie erringen Siege ganz anderer Art.
Protagonisten sind auch die Kranken selbst – besonders in diesem Bühnenstück.
Kurz vor der Schlussszene sind alle Darsteller auf der Bühne. In einem Pflegeheim hören die Demenzkranken einfach auf, der monotonen Choreographie ihrer Pfleger zu folgen. Ausgerechnet ihr erkrankter Geist macht sie in dieser Szene unempfindlich gegen die kühle Routine des Personals.

Während die Heimleiterin die Vorzüge ihres Hauses schildert, werden die Bewohner mit kühler Routine abgespeist.
Dann sollen sie unter dem Dirigat eines Herrn Sibelius Lieder singen. Sie quäken ohrenbetäubend schräg. Eine alte Dame quäkt nicht mit. Sie zieht sich aufwendig die Lippen nach. Und plötzlich kommt in ihrem Hirn eine Verbindung zustande: ihre Lippen, der knallrote Stift, ein Lied, da war doch etwas! Diese Zutaten gehören doch irgendwie zusammen!
Und mitten ins Dirigat von Herrn Sibelius schreit sie den alten Liedsatz, der ihr einfällt: „Rote Lippen soll man küssen.“ Schon fallen alle Heimbewohner singend – und richtig singend – ein: „Rote Lippen soll man küssen.“ Sofort ist Leben auf der Bühne. Die Bewohner berühren sich, beginnen zu tanzen, Freude in allen Gesichtern, Bewegung sogar bei den Alten an ihren Rollatoren. Einer rockt auf Rädern die Bühne. Die Dame mit den knallroten Lippen hinterlässt ihren Kussmund auf, richtig: Männerwangen.

Noch glaubt Dirigent Sibelius (vorn, mit Schal), er habe alles im Griff; dabei hat die Dame hinter ihm den Lippenstift bereits gezückt.

Und plötzlich tanzt der Bär – dargestellt vor allem von Mitgliedern des Ludgerus-Kirchenchors (er soll sich schwer getan haben, „schräg“ zu singen).
All das ist grandios, vielsagend und berührend. Wer weiß schon, was sich in einem erkrankten Menschen ereignet.
So treffen auch Patienten, die obdachlos im eigenen Geist geworden sind, auf ein Stück Heimat – in Liedern, in Geschichten von vorvorgestern, in einer Puppe oder einem altvertrauten Gebet aus Kindertagen.
Nie ist nichts.
In dieser Sangesszene sind es die Dementen, die als Hauptakteure des Lebens auf der Bühne stehen und den Bär tanzen lassen – eine der gezielten Verkehrungen in diesem Bühnenstück, die einen sprachlos machen können.
Manche Szenen gebären eine eigene Poesie – zum Beispiel die, in der Oma Roth nächtens in ihrem Schlafzimmer randaliert. Sie sucht wie immer nach ihrem längst verstorbenen Opa Roth, denn „er muss ja noch sein Essen haben“. Die Schwiegertochter geht mit ihr hinaus in die Nacht. Die ist viel zu weit fortgeschritten, um Essen zu machen. „Siehst du“, sagt sie zur Oma, „es ist alles dunkel. So viele Sterne.“
Ganz langsam kommen Darsteller auf die dunkle Bühne und zünden Lichter an. Oma Roth staunt: „Ja, so viele Sterne.“ In der Dunkelheit erlebt sie einen hellen Moment. „Oh Gott, was ist bloß mit meinem Kopf los? Es ist Nacht.“
Das geht tief unter die Haut. Unter den Akteuren und im Publikum ist es furchtbar still.
In der Schlussszene kommen die jungen Darsteller nach und nach auf die Bühne. Sie erinnern sich an den großen Reigen im Pflegeheim. „Das war ein Fest des Lebens“, sagt einer. „Das war ein Traum“, sagt der nächste. Und dann entfalten sie als Angehörige ihre Träume.
„In einem Traum kann ich deine Stimme klar und deutlich hören.“
„In einem Traum kann ich dein Lachen hören.“
„In einem Traum tröstest du mich.“
„In einem Traum liebst du mich. “
„In einem Traum reise ich mit dir.“
„In einem Traum tanze ich mit dir.“
„In einem Traum lebe ich mit dir“
„Und du mit mir“
„So wie du warst.“
„Wenn du verschwindest“, flüstern alle Angehörigen gemeinsam ihren Trost, „wenn du verschwindest, bleibt immer noch ein Teil von dir.“
Der letzte Satz in diesem Stück ist gesagt, der letzte Ton verklungen. Über 600 Theaterfreunde erheben sich. Sie klatschen und wollen nicht aufhören. Sie verfallen nicht in rhythmischen Beifall und stampfen keine Rakete. Es ist, als hätten sie Sorge, ein Zuviel an munterer Zuwendung könne die Leistung und den Ernst der aufführenden Kinder und Jugendlichen stören.
Dieses Theater ist kein Jubelstück, sondern ein Stück menschlichen Lebens. Eine weitere Aufführung ist nicht geplant. Dabei ist sie vielen zu wünschen.
Text und Fotos: Delia Evers
Hintergründe zum Stück, Personalien sowie Porträts der Theaterfamilie und der Alzheimer Gesellschaft sind hier hinterlegt.

Zur Vormittagsvorstellung kamen rund 400 Gäste, abends waren es deutlich über 600. Im Bildvordergrund der Schirmherr der Aufführung, Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst.

Die Verantwortlichen beim Dankeschön der Alzheimer Gesellschaft, der Theaterfamilie und des Publikums: v.l. in Schwarz Dr. Elke Warmuth, Claus Gosmann und Isburga Dietrich.

Der letzte Akt: Hinter den Kulissen sind Mitglieder des Anpackerkreises von St. Ludgerus aktiv, natürlich auch beim Aufräumen.