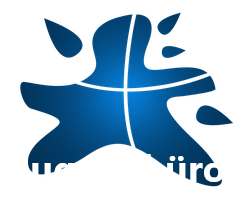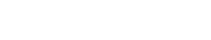Heinelt, Hubert | Pfarrer i.R.
Ein Portrait zum Goldenen Priesterjubiläum | Von Delia Evers
 Am Freitag, 30. Januar 2015, feierte Pfarrer i.R. Hubert Heinelt in St. Willehad in Esens sein Goldenes Priesterjubiläum mit einen Dank- und Jubiläumsgottesdienst, gestaltet von Pfarrer Matthias Schneider und Pastor Karl Terhorst. Viele Auricher erinnern sich gern an den Mann, der hier in den 70er- und 80er-Jahren mit anderen Priestern in einem Konvent lebte, die Jugend betreute und alte Zöpfe kappte.
Am Freitag, 30. Januar 2015, feierte Pfarrer i.R. Hubert Heinelt in St. Willehad in Esens sein Goldenes Priesterjubiläum mit einen Dank- und Jubiläumsgottesdienst, gestaltet von Pfarrer Matthias Schneider und Pastor Karl Terhorst. Viele Auricher erinnern sich gern an den Mann, der hier in den 70er- und 80er-Jahren mit anderen Priestern in einem Konvent lebte, die Jugend betreute und alte Zöpfe kappte.
Hubert Heinelt wurde am 26. Mai 1938 als jüngster von drei Brüdern im schlesischen Breslau geboren. Im Jahr darauf begann der Krieg. 1940 wurde Vater Georg eingezogen und an die russische Front beordert. Acht Jahre blieb er in Krieg und Gefangenschaft und fehlte der Familie.
Mutter „Käthe“ Katharina schenkte ihren drei Jungen viel Aufmerksamkeit. Sie schickte sie in die Ortskirche, wo sie mit Oblatenpatres in Kontakt kamen, die ihr Leben ganz Gott hingeben wollten. „Die Kirche wurde für uns eine Art Vaterersatz“, und Hubert erhielt eine erste Vorlage für seinen späteren Beruf.
Die drei Brüder waren vor Ende des Kriegs elf, zehn und sechs Jahre alt; die beiden Älteren standen als Messdiener im Altarraum. Da wollte Hubert auch hin.
Gern erinnert er sich daran, wie die Mutter mit ihm, wenn er zu Bett gegangen war, noch sang. Der kleine Hubert liebte diese innige Zeit im Warmen und Vertrauten. Meist stimmte die Mutter Lieder an, die liturgisch für den folgenden Sonntag im Gottesdienst zu erwarten waren. Texte und Melodien lernte er schnell. „Wenn ich dann im Gottesdienst war, und ich sah vorn am Altar meine Brüder, und die Orgel spielte die ersten Töne, und ich wusste, was kommen würde, freute ich mich schon.“ Die Musik liebt er bis heute.
 Immer wieder begleitete Hubert Heinelt im Lauf der Jahrzehnte Ereignisse auch auf der Gitarre.
Immer wieder begleitete Hubert Heinelt im Lauf der Jahrzehnte Ereignisse auch auf der Gitarre.
Auf Breslau fielen Bomben. Gemeinsam mit seiner Mutter sah er zum ersten Mal in seinem Leben kriegszerstörte Häuser. Er hatte keine Angst. „Ich habe mich an den Mantel meiner Mutter gedrückt. Ich war in ihrem Schutz.“
Ende Januar 1945 kam der Evakuierungsbefehl. Breslau war zur Festung gegen die vorrückende Rote Armee erklärt worden. Die Zivilbevölkerung musste raus aus der Stadt. Der Winter war streng und Breslau überfüllt, denn längst hatten Flüchtlinge aus dem östlichen Odertiefland in langen Trecks die Stadt geflutet. Als Anfang Februar die Panik immer größer wurde, weil die Eisenbahnzüge die Menschenmassen nicht aufnehmen konnten, und Frauen und Kinder auf einen Fußmarsch gezwungen wurden, den Tausende in klirrender Kälte mit dem Leben bezahlten, war die Familie Heinelt bereits geflohen.
Sie hatte sich unmittelbar, nachdem die Rote Armee am 28. Januar 1945 das KZ Auschwitz befreit und am 30. Januar 1945 in der Ostsee die „Wilhelm Gustloff“ mit mehr als 10.000 Menschen an Bord versenkt hatte, auf den Weg gemacht. Hubert spürte die Ängste, die Hilflosigkeit und die Planlosigkeit der Mutter, die ihn doch immer geschützt hatte, und fiel irritiert selbst in Angst. „Was sollten wir tun? Wo sollten wir hin? Also erst mal rein in einen Zug und weg!“ Die Dampflokomotive sieht er noch vor sich. Sie brachte die Familie über Berlin nach Hamburg.
Wieder war es die Kirche, die ihnen Halt und Schutz gab. Auf Vermittlung einer Verwandten kamen sie nach Hamburg-Reinbek. Hier wirkte in einem Kloster der Schwestern von der Heiligen Elisabeth eine Großtante als Nonne. Sie konnte Familie Heinelt, die schließlich in Zwölfer-Stärke vor der Pforte stand, in einem Haus unterbringen, das zum Klosterensemble gehörte. Die Nonnen freuten sich über die Heinelt-Jungen, die fortan ministrierten. „Manchmal steckten sie uns etwas zu.“
Auch die Jungen gaben ihr Bestes und waren bei den Nonnen gern gesehen. „Das hat uns gestärkt.“
Die Brüder gingen wieder zur Schule. Wenn Ferien gewesen waren, fragte der Lehrer, was die Kinder mit Mutter und Vater unternommen hätten. Hubert hatte nichts mit seinem Vater unternommen. Der Junge begann zu stottern, „aber nur in der Schule.“ Die Mutter blieb bei ihrem Satz: „Papa kommt wieder!“ Für den Vater „beteten wir kniend am Tisch den Rosenkranz.“ Ein Jahr lang war der Vater vermisst, dann erhielten sie die Nachricht, dass er lebte. Eines Tages – 1948 – hieß es: Er kommt morgen mit dem Zug.
Sie gingen in Reinbek zum Bahnhof. Hubert hatte sich Vorstellungen von seinem Vater gemacht. Als er den heruntergekommenen und verlausten Mann wie einen Bettler vor sich stehen sah, schämte er sich.
 Hubert Heinelt in seiner Wohnung in Esens.
Hubert Heinelt in seiner Wohnung in Esens.
Hubert Heinelt war längst schon Pfarrer in Esens, als der Vater ihn wie so oft besuchte und gestand, dass er damals – 1948 – seine Frau Käthe kaum erkannt habe. Als er an die Front musste, sei sie für ihn, den gestandenen und erfolgreichen Kaufmann eines Feinkostgeschäftes in Breslau, wie ein Mauerblümchen gewesen. Bei seiner Rückkehr hatte er eine starke Frau vorgefunden, die alles regelte. Das sei schwer für ihn gewesen, zumal er selbst schwach und arbeitslos gewesen sei.
Die Jungen machten ihren Vater mit der neuen Politik vertraut, erzählten von Konrad Adenauer, Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer. „Vater wusste ja nichts.“ Die Familie half ihm ins Leben zurück. Hubert besserte die Haushaltskasse auf. Jeden Tag trug er drei Stunden lang das Hamburger Abendblatt aus.
Überhaupt der Familienzusammenhalt: Das gemeinsame Leben war geprägt von Vertrauen. Wenn die Jungen ausgingen, reichte der mütterliche Hinweis: „Kommt nicht zu spät nach Hause.“ Nie wäre den Söhnen eingefallen, das Vertrauen zu missbrauchen, das keine bindende Abmachung brauchte.
Einmal blieb Hubert in der Schule sitzen. Er war immer „der kleine Star“ gewesen. Das Sitzenbleiben kam genau richtig für eine Lektion: Setze deine Kräfte da ein, wo sie im Moment am ehesten gebraucht werden. Er bekam keine Standpauke, die Lektion reichte.
Immer wieder kam er mit Priestern in Kontakt, die ihn beeindruckten. Ein junger Kaplan förderte Hubert besonders, lud ihn zur Beichte ein, inspirierte ihn, traute ihm, der längst wie seine Brüder Messdiener war, etwas zu, führte ihn an Aufgaben heran; und ohne dass Hubert Heinelt groß etwas merkte, „wuchs ich langsam in Verantwortung hinein.“ So hielt er es später selbst, als er seine ersten Messdienergruppen leitete.
In der Oberprima ging plötzlich die Post ab. Er las Goethes Faust I. Die Gedanken und Fragen sprangen ihn an. Faust im Studierzimmer, seine Zweifel, wie der Beginn des Johannes-Evangeliums richtig zu übersetzen sei. Was war im Anfang: Das Wort? Der Sinn? Die Kraft? Faust entscheidet sich: „Im Anfang war die Tat.“
Die Oberprima besuchte im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg die längst legendäre Neuinszenierung des Faust unter Regie und Intendanz von Gustaf Gründgens mit Will Quadflieg als Faust und Gründgens als Mephisto. Ganz großes Theater. Und ein ganz großes Erlebnis für die Jungen.
Sie diskutierten, philosophierten über die Wette mit dem Teufel, über Glück und über das, was die Welt im Innersten zusammenhält. In Hubert Heinelt war etwas aufgebrochen.
An der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt, die den Jesuiten anvertraut ist, begann er sein Theologiestudium bei guten Professoren. „Das war wie eine Fortsetzung von Faust I„, sagt er heute.
Der neue Papst Johannes XXIII. verstärkte das Suchen und Fragen mit den bahnbrechenden Veränderungen, die er auf den Weg brachte. „Diese Phase vor dem Konzil war wie ein Rausch. Johannes hat uns Feuer unter den Hintern gesetzt und geistig voll erwischt – ähnlich wie heute Franziskus.“
Viele Priesteranwärter – Heinelt besuchte das Priesterseminar in Osnabrück – und Geistliche hinterfragten das eigene Priesterbild, sahen sich plötzlich mitten in die Welt gestellt, runtergerutscht von den Rössern, an der Seite der Arbeiter und Arbeitslosen. Sie wollten als Arbeiterpriester in die Fabriken, um wie jedermann ihr eigenes Geld zu verdienen und Seite an Seite den normalen Wahnsinn des Lebens zu teilen. „Wir wussten: Wir müssen an die Ränder der Gesellschaft gehen, um bei den Menschen zu sein. Das hat mich fasziniert.“
Mit dem Zweiten Vaticanum waren Arbeiterpriester, die oft Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaften gewesen waren und deren körperliche Tätigkeiten verboten worden waren, wieder erlaubt.
„Wir waren damals zukunftsorientiert, wir wollten Freiheit in Verantwortung.“ Sie dachten sie sich auch für die Sexualität. Den Zölibat glaubten sie am Ende. „Sexualität musste von der Gottesliebe her verantwortet werden“ – wie alles andere auch; dann war es gut: Das war ihre feste Überzeugung.
Doch bald erstarrte das Leben in alten Verkrustungen.
Was hatte die Kirche falsch gemacht?
Hubert Heinelt formuliert die Frage freundlich um. Er möchte lieber beantworten, was erfalsch gemacht hat.
Nachdem er am 30. Januar 1965 von Bischof Helmut Hermann Wittler im Osnabrücker Dom zum Priester geweiht worden war, waren er und junge Kollegen voll hochfliegender Pläne. „Wir wollten die Menschen retten.“ Sie glaubten, den Schlüssel in der Hand zu haben. „Der Glaube machte uns frei.“ Doch plötzlich sagten Katholiken: „Der Glaube macht uns nicht frei; wenn wir aber frei sind, brauchen wir nicht mehr in die Kirche zu gehen.“ Das erste Joch, das viele abstreiften, war das der tradierten Zwänge. Mit den Zwängen blieb vielfach das Vertraute und das Haltgebende und das verantwortete Miteinander auf der Strecke.
„Wir haben versucht, Gläubige aus dem Zwang direkt in die Freiheit zu führen. Das hätte peu à peu passieren müssen.“
Hubert Heinelt hatte in seiner Kinder- und Jugendzeit eine solche Schritt-für-Schritt-Führung erfahren dürfen, eine, die ihm in dem Maße, wie er reifte, etwas zutraute und Verantwortung übertrug. Das erlebte er besonders in Zeltlagern. Hier konnten junge Menschen sich austoben und zugleich behutsam in Aufgaben für andere hineinwachsen. Da fand sich für jeden ein Dienst am Nächsten. „In einem Zeltlager kann man alles lernen.“
Er selbst ging vorbehaltlos auf andere zu – und besonders wie in seiner Sturm- und Drangzeit auf die Menschen an den Rändern der Gesellschaft. „Da kommt man automatisch runter vom Roß.“ Heinelt nennt das „Pastoral Auge in Auge“. Da lerne man schnell, Menschen nicht über einen Kamm zu scheren. Kein Konzept passe auf alle. Jede Not habe ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Anforderungen an Hilfe. Das hatte er selbst erfahren. „Die eigene Not konnte ich gut verwerten.“
Braucht das Leben Leid, um Verwertbares herzugeben? Heinelt antwortet mit einer Gegenfrage: „Wie erfährt man Leid? Wie kommt es an einen heran. Als Kind habe ich gehungert. Das war Leid. Meine Mutter streichelte mich. Und das Leid war vorbei.“ Leid brauche Menschen, die es linderten.
Seine ersten Stationen als Priester waren Osnabrück, Eutin in Holstein und Hagen im Teutoburger Wald. 1971 wurde er Pfarrer in Esens. Das Feuer war noch immer da. Er und einige Mitpriester suchten neue Formen des Zusammenlebens. So gründeten Heinelt und die Pastoren Norbert Krümel, Heinrich Munk und Peter Jonen für ihren Beritt mit Aurich, Esens, Oldersum und Spiekeroog den „Konvent Ostfriesland“. Sie wollten das Beste vor Ort möglich machen und sortierten ihre Talente. Hubert Heinelt „übernahm“ Jugend, Krankenhausseelsorge, Messdiener und: Messdienerinnen; in Heinelts Zeit sahen Kirchgänger die ersten Mädchen im Dienst am Altar.
Jahrzehnte sind vergangen. 33 Jahre, von 1971 bis 2004, hat Hubert Heinelt vor allem in der St.-Willehad-Gemeinde in Esens und in St. Peter auf Spiekeroog gewirkt; Aufgaben in St. Bonifatius Wittmund und St. Nikolaus Langeoog kamen hinzu. Immer schaffte er es, Menschen zu begeistern und in den Dienst Christi zu stellen. Nach der Esens-Zeit wechselte er mit einer Gemeindeschwester für dreieinhalb Jahre nach Juist, ehe er 2008 in „seine“ Stadt zurückkehrte, die ihn 1999 für sein außerordentliches Engagement mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet hatte.
Vier Wochen nach seiner Rückkehr erlitt er auf dem Weg nach Brasilien bei einem Zwischenstopp in Lissabon einen Schlaganfall. Er war halbseitig gelähmt und hatte seine Sprache verloren. Der, der immer alles hatte bewegen wollen, Zeit seines Lebens passioniert Fußball, Handball und Tischtennis gespielt hatte und regelmäßig die weitesten Strecken mit dem Rad gefahren war, brauchte unversehens Menschen an seiner Seite, die sein Leid linderten. Sehr schnell waren seine beiden Brüder da und stärkten ihn ebenso wie das medizinische Personal und seine Freunde.
Heute sagt er ohne Koketterie, der Schlaganfall sei die beste Vorbereitung aufs Altern gewesen. „Auch das will gelernt sein.“
Längst läuft und radelt er wieder, ist ein Erzähler vor dem Herrn, singt in Chören und ist als „Basisarbeiter“ noch immer den Aufgaben zugetan, in denen er Augennähe herstellen kann: in der Krankenhausseelsorge, im Hospizdienst, in einer Seniorengruppe, in der Flüchtlingsbetreuung und in einem Arbeitskreis Juden und Christen.
Auricher, die ihn in den 70er- und 80er-Jahren vor Ort erlebt haben, schwärmen von Heinelts Arbeit, seinem schlichten Auftritt, seiner mitreißenden Art, seiner Motivationskraft und seiner Gabe, Kinder und Jugendliche durch Zutrauen und Zumutung beim Reifen zu begleiten.
Hubert Heinelt lächelt. Von Aurich hat er gerade wieder Erhebendes gehört. Es freut ihn ungemein, dass dort gute Jugendarbeit zu Hause ist. Das ganze Gesicht strahlt.
Er sagt, als wundere er sich selbst ein bisschen: „Das Feuer brennt immer noch.“